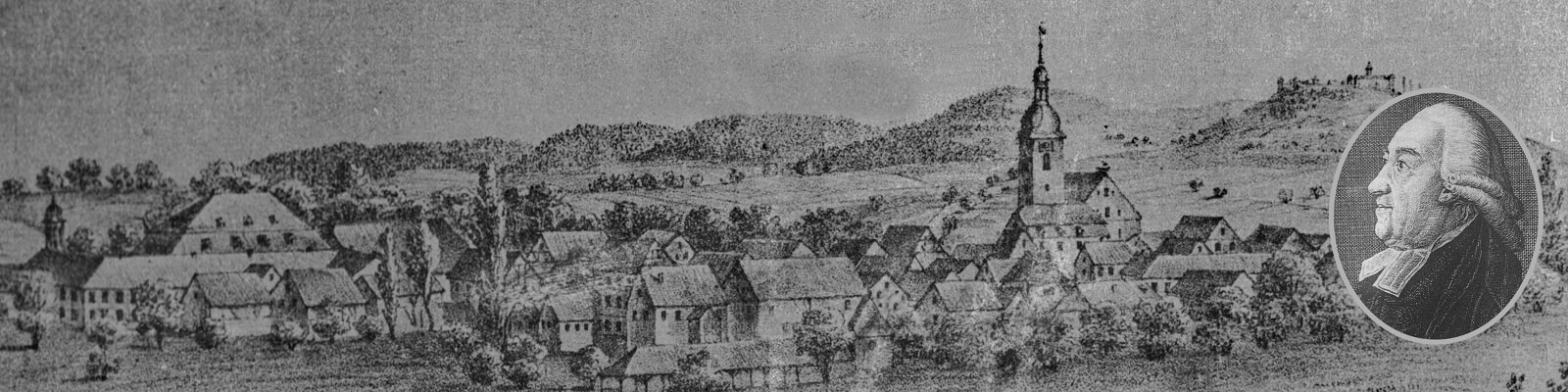500 Jahre Deutscher Bauernkrieg
Anlässlich der Mitgliederversammlung der Pfarrer J. F. Mayer-Gesellschaft (PMG) in Kupferzell warf Tillmann Zeller in seinem Vortrag zum „Bauernkrieg 1525“ einen Blick auf die Lebensumstände der Bauern und die Ereignisse speziell im süddeutschen Raum und die hiesigen Protagonisten zu jener Zeit.
Der Aufstand und seine Ursachen
Wesentlicher Treiber für den Aufruhr des dritten Standes war die zunehmende wirtschaftliche Not. Sie war die Folge von immer mehr Steuern, Zöllen, Abgaben und Frondiensten. Eine wichtige Rolle spielten auch Missernten und immer kleiner Ertragsflächen durch die Realteilung. Der Aufstand richtete sich maßgeblich gegen die Vorrechte des Adels und der Kirche. Ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen den Bauernaufständen und der reformatorischen Bewegung. Auch wenn sich Martin Luther klar von den Aufständischen distanzierte, wirkten seine Schriften und die Übersetzung den Neuen Testaments ins Deutsche als Antrieb und Rechtfertigung für das Aufbegehren gegen das von weltlicher und katholischer Obrigkeit getragene System der sozialen Ungerechtigkeit. Anschaulich stellte Zeller, ehemals Fachlehrer in Bad Mergentheim und Gründungs-Vorstandsmitglied der PMG, die Anführer und Schlachten der aufständischen „Haufen“ in den verschiedene Regionen vor. Ausgehend von ersten Unruhen im Schwarzwald ist in der Anfangsphase des Bauernkriegs durch das schnelle Übergreifen auf Nachbargebiete ein Flächenbrand entstanden.
Das Manifest mit zwölf Artikeln
Zunächst wählten die Aufständischen das Wort als Waffe. Die im Memmingen Manifest formulierten „Zwölf Artikel“ werden heute als erste Menschenrechtserklärung betrachtet. In Demonstrationsmärschen konnten die Aufständischen nahezu alle Städte und Ämter auf ihre Seite bringen. Der Vertrag von Grünbühl am 11. April 1525 gilt als einer der größten Erfolge der Bauern. Auf freiem Feld unterhalb Waldenburgs müssen die Grafen von Hohenlohe auf die zwölf Artikel schwören und sich dem Haufen anschließen.
Doch war die Bluttat zu Ostern 1525 mit zahlreichen ermordeten Adeligen bei Einnahme der Stadt Weinsberg ein Weckruf für die Herrschenden. Mit ihrer Hinhaltetaktik trug sie letztlich zur Spaltung und Unentschlossenheit der Aufständischen bei und zum raschen Sieg der Truppen des Schwäbischen Bundes, der Vereinigung schwäbischer Fürsten, Adeliger, Prälaten und Reichsstädte. Die Truppen standen unter dem Kommando von Truchsess Georg III. von Waldburg-Zeil, genannt der „Bauernjörg“. Schätzungen gehen von etwa 70.000 Personen aus, die vor allem in den zahlreichen großen Schlachten der ersten Massenerhebung der deutschen Geschichte zu Tode kamen.

Tillmann Zeller (r.) bei der Mitgliederversammlung der Pfarrer Mayer-Gesellschaft in Kupferzell. Foto: Bernauer
In der weiteren Geschichtsschreibung wurde der Bauernkrieg von unterschiedlichsten Seiten vereinnahmt. Der Nationalsozialismus erklärte das Scheitern der Aufstände mit dem Fehlen eines geeigneten „Führers“. In der früheren DDR war der Aufstand der Vorläufer für den Kampf eines sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaats. In der Bundesrepublik wurde der Bauernkrieg dagegen immer wieder als Symbol für Protestbewegungen verwendet, zum Beispiel der Bundschuh. Für die Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg spricht nach Zellers Worten die Tatsache, dass die Rolle von Macht, Herrschaft und Gewalt leider auch heute das aktuelle und geschichtlich zentrale Thema der Menschheit ist. Gerhard Bernauer